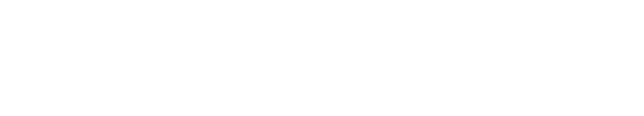The Impact of Environmental Cooperation on Peacemaking: Definitions, Mechanisms, and Empirical Evidence (auf Englisch)
Environmental Cooperation as a tool for crisis prevention and post-conflict rehabilitation (auf Englisch)
Kriege haben in der Regel verheerende Auswirkungen auf die Umwelt. Vietnams Wälder, die nach dem Einsatz von Millionen von Litern Agent Orange ihre Blätter verloren, sind eines der besten Beispiele. In den letzten Jahrzehnten ist immer deutlicher geworden, dass auch das Gegenteil der Fall ist; Umweltzerstörung spielt eine Rolle als Ursache und Verstärker gewalttätiger Konflikte. Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Menschen versuchten, die Einzigartigkeit von Umweltproblemen auch positiv zu nutzen.
Die Natur ignoriert von Menschen geschaffene Grenzen, d.h. Umweltprobleme betreffen nicht selten mehrere verfeindete Gemeinschaften. Dadurch haben die Betroffenen einen Anreiz, das Problem gemeinsam zu lösen. Das Konzept der ökologischen Friedensförderung war geboren. Es basiert auf der Idee, dass verfeindete Gruppen ihre Differenzen angesichts gemeinsamer Umweltprobleme beiseitelegen und sich zu Dialog und Zusammenarbeit vereinen. Da die Konfliktparteien Wälder und Flusseinzugsgebiete gemeinsam bewirtschaften, folgt die Schaffung gemeinsamer Institutionen und gleichzeitig verbessert sich die Umweltsituation stetig. Auf dem Weg dorthin lösen sich Misstrauen und Spannungen, was die allgemeinen Beziehungen zwischen den Gruppen friedlicher macht. Mit zunehmender Interdependenz und neuen Kommunikationskanälen wird eine Konflikteskalation immer unwahrscheinlicher. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die ökologische Friedensförderung ein phänomenales Versprechen beinhaltet, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Umweltprobleme und Konflikte.
So gut es in der Theorie auch klingt, die Realität ist ernüchternd. Es müssen viele Bedingungen erfüllt sein, damit sich diese friedensstiftenden Mechanismen entfalten. Wenn die Betroffenen die Vorteile der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit z.B. als ungerecht verteilt empfinden, kann sie sogar einen Konflikt verschärfen. Trotz der hohen Erwartungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Zusammenarbeit im Umweltbereich zu breiteren Formen der Zusammenarbeit führt, bei der sich der politische Dialog auf Umweltaspekte beschränkt. Auch wenn Umweltinstitutionen funktionierende Kommunikationskanäle bereitstellen, scheinen die Entscheidungsträger diese bei sich abzeichnenden militärischen Konfrontationen nicht zu nutzen. Und wenn die Spannungen zwischen den Gemeinschaften zunehmen, kann die Kooperation schnell zum Erliegen kommen. Noch schlimmer ist, dass grenzüberschreitende Schutzinitiativen von Staaten missbraucht werden können, um Konflikte um Mineralien und Territorien in den Schatten zu stellen und militärische Aktionen zu rechtfertigen. Abschliessend sei gesagt, dass, auch wenn es Erfolgsgeschichten gibt, die Erwartungen realistisch gehalten werden müssen.