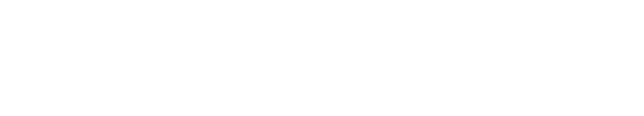Bosnien-Herzegowina und Ruanda waren Zeugen der grössten humanitären Katastrophen, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Nach dem Ende der Grausamkeiten rückten die Friedensförderung und die Suche nach Stabilität in den Fokus der nationalen und internationalen Akteure. Viele Stimmen argumentieren, dass Makro-Strukturen zu einem stabilen Frieden führen würden und dass Wirtschaftswachstum kombiniert mit politischen Erfolgen die Brüche innerhalb der Gesellschaft heilen könnten. Andere hingegen behaupten, dass solche Anstrengungen alleine nicht ausreichend seien, um eine nationale Wiederversöhnung herbeizuführen. Die Traumata der Konflikte müssten auch auf individueller und persönlicher Ebene verarbeitet werden. So eine Herangehensweise würde nicht nur politischen Frieden garantieren, sondern auch Frieden innerhalb der Bevölkerung. Damit dies gelingen kann, müssen die psychosozialen Auswirkungen des Konflikts adressiert werden. Ansonsten würden weiterhin Vergeltung und Vorurteile gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen vorherrschen. Somit würde das Risiko, trotz wirtschaftlichem und politischem Erfolg, für weitere Konflikte bestehen bleiben. Im Folgenden werden zwei Artikel präsentiert, welche die Relevanz solcher Massnahmen in Ruanda und Bosnien-Herzegowina illustrieren. Zwei Länder in denen die psychosoziale Aufarbeitung besonders wichtig ist, da wegen der relativ kleinen Fläche, Täter und Opfer weiterhin Tür an Tür leben.
Die Erkenntnis, dass Frieden nicht nur auf einem Makro-Level in der Gesellschaft in Erscheinung tritt, sondern auch in Mikro-Strukturen, wird in Hart und Colos Artikel zu Bosnien-Herzegowina deutlich. Der Autor und die Autorin präsentieren darin Fälle von psychosozialer Versöhnung. Diese Friedenförderungsprojekte zielen darauf ab, die Bedürfnisse von Personen und Gemeinschaften ganzheitlich zu verstehen, um einen gesellschaftlichen Wandel zu ermöglichen, der sich nicht auf eine Täter-Opfer Dichotomie festlegt. In Bosnien-Herzegowina haben sich die Beziehungen zwischen den Menschen von einem gegenseitigen Vertrauen und Freundschaftsverhältnis, in ein Verhältnis von Unsicherheit und «Angst vor dem anderen» gewandelt. Dadurch wurden die gemeinschaftlichen Banden gegenüber der eigenen Ethnie und Religion gestärkt und gegenüber der jeweils anderen zerstört. Deshalb kann Wandel nicht nur von institutioneller Ebene herkommen, sondern benötigt eine nachbarschaftliche Versöhnung. Das Ziel der Projekte war es, Beziehungsbanden zwischen den Gruppen neu zu knüpfen, indem man Räume schafft, wo sie sich ihre persönlichen Geschichten erzählen konnten. Dieses psychosoziale Geschichtenerzählen erlaubt von Schmerz, Wut und Angst wegzukommen und offen zu sein für das Verständnis von gegenseitigen Interessen und Bedürfnissen. Eine solche psychosoziale Art der Friedensförderung ermöglicht einen Einblick in die fassbaren und auch nicht fassbaren Elemente, die in einem Nachkriegsland und in Konfliktsituationen anzutreffen sind. Diese geben Einblicke in Wandlungsmöglichkeiten in eine friedliche Gesellschaft.
Genau dieses Potential ist auch im Artikel über Ruanda beschrieben. Der Autor und die Autorin kritisieren jene Friedensförderung, die sich ausschliesslich auf die Staatsbildung konzentriert und fordern Methoden die auch Einzelschicksale berücksichtigen. Der psychosoziale Ansatz verfolgt dieses Ziel. Dieser individuelle Ansatz zielt darauf ab, die soziale Widerstandsfähigkeit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Die Gesellschaft soll auf einem interpersönlichen Level wieder zusammengebracht werden. In Ruanda hat der soziale, politische und ökonomische Wandel diesen Aspekt ignoriert und die Transformation nicht gut genug in der psychosozialen Ebene verankert – was für nachhaltigen Frieden unerlässlich ist. Das Fallbeispiel Ruanda zeigt die Relevanz von ganzheitlichen Mikroansätzen auf, die soziale Dienste leisten, um sich den psychischen und emotionalen Bedürfnisse der Leute anzunehmen. Diese ergänzen die Bedürfnisse nach Nahrung und Sicherheit. Deshalb ist die Lektion aus Ruanda, dass psychosoziale Interventionen als fundamentale Bestandteile von Friedensförderungsmodellen angesehen werden müssen.
Die Spaltung zwischen ethnischen Gemeinschaften erinnern an den Krieg und die einhergehenden Traumata. Das Erzählen der eigenen Geschichte, psychologische Hilfestellungen und ein Austausch können erneut Empathie und Sympathien zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen schaffen. Die Beziehungen zwischen Tätern und Opfern werden klarer formuliert und ein gegenseitiges Verständnis der eignen Geschichte wird ermöglicht. Die Lektionen aus Ruanda und Bosnien-Herzegowina können auch in anderen Kontexten, wo es ethnische Spannungen gibt, angewendet werden. Psychosoziale Interventionen können eine Richtung weisen, die zu mehr gemeinsamer sozialer Aktion führt. Nichtsdestotrotz brauchen solche Methoden nicht nur kompetente Leute, aber auch die Bereitschaft der Mitglieder der Gesellschaft sich der Partnerschaft für Frieden und Wandel anzuschliessen.